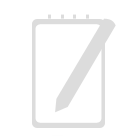Wie der Mensch auf den Hund kam
Vor ca. 15.000 Jahren begann es, dass sich einige mutige Wölfe der Gattung Canis Lupus (Grauwolf) den menschlichen Siedlungen genähert haben. Der Mensch holte die Wolfswelpen zu sich ans Lagerfeuer. Damit begann die Domestizierung des Wildtiers – und die einzigartige Symbiose zwischen Mensch und Hund. Er wurde Jagdgefährte, Wach- und Hütehund, Lawinensucher, Drogenschnüffler, Blindenbegleiter und ist bis heute vor allem eins: ein treuer Freund des Menschen.
Die nützlichen Eigenschaften der Wölfe haben den Menschen wohl zu diesem Schritt bewogen: Die Tiere konnten durch ihr Verhalten vor Gefahren warnen, waren die Müllabfuhr für Essensreste und dienten als Wärmespender in kalten Nächten. Möglich ist allerdings auch, dass sie zunächst noch als lebender Fleischvorrat dienten. Bereits die Menschen am Ende der letzten Eiszeit haben wohl Tiere ausgewählt, die weniger aggressiv waren als ihre noch gänzlich wilden Artgenossen und die den Gefangenschaftsstress in menschlicher Obhut gut verkrafteten. Und diese Tiere haben sie gekreuzt. Mit der Domestizierung begann also die Zucht – der Mensch machte den Hund zu seinem Geschöpf.
Damit beginnt eine äußerst effektive Symbiose. Etwa bei der Jagd. Am Ende der Eiszeit bereiteten sich in Europa Wälder aus, Tiere zu erlegen wurde schwieriger. Menschen erfanden Pfeil und Bogen, gingen auf die Pirsch. Die gezähmten Wölfe halfen bei der Jagd, sie apportierten erlegtes Wild, bewachten die Lager der Menschen, wahrscheinlich wurden sie auch vor Schlitten gespannt. Und wenn man sich vorstellt, wie rau und gefährlich das Leben der Waldbewohner in jenen Tagen gewesen sein muss, ist auch nicht auszuschließen, dass sie eine emotionale Bindung zu ihren gezähmten neuen Begleitern entwickelten.
So war der Hund wohl schon früh beides: nützlicher Helfer und sozialer Partner. Doch hat er gerade als Nutztier harte Zeiten durchlebt. Bis zur Industrialisierung wurden Hunde auf Bauernhöfen schon mal in Laufräder gesperrt, die Buttermaschinen oder Kohlschneider antrieben oder in Großküchen Bratenspieße drehten. Nagelbretter am Ende der Tretfläche hielten die Hunde in Bewegung.
Im ersten Weltkrieg schickte man Hunde als Melde-, Sanitäts- und Lasttiere auf die Schlachtfelder und ließ sie etwas Munition transportieren. Im zweiten Weltkrieg wurden sie sogar darauf trainiert, mit dem Fallschirm abzuspringen und jenseits der Fronten zu operieren. Die Kriegshund-Tradition reicht zurück bis in die Antike.
Schon griechische und assyrische Armeen schickten ihren Kämpfern Hunde voraus, die gegnerische Angriffe auf sich ziehen oder den Feind aufspüren sollten. Fackeln am Halsband sollten die Gegner erschrecken und verwirren. Alt ist auch die brutale Tradition, die Tiere als Kampfhunde abzurichten. Schon die Römer sollen daran Vergnügen gefunden haben. Blütezeit der Hundekämpfe wurden aber das 18. Und frühe 19. Jahrhundert. Hunde mussten nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen Ratten, Dachse, Bären, Löwen und Bullen kämpfen. Erst gegen Mitte des 19. Jahrhunderts wurde diese grausame Unterhaltung in Europa verboten.
Doch spätestens seit dem Mittelalter gab es auch „unnütze Hunde“, Tiere, die um ihrer selbst willen gehalten wurden, aus Freude am Tiere – und aus Rührung über seine Zuneigung. Natürlich gab es Moden, Seidenhündchen im Barock, der Mops im Rokoko, der Spitz im Klassizismus. Doch ging mit der Vernarrtheit in bestimmte Rassen immerhin einher, im Hund kein wertloses Ding mehr zu sehen.
Natürlich ist die Vermenschlichung des Hundes heute ein großes Problem. Denn was bleibt den Vierbeinern, wenn sie mit Pralinen gefüttert oder in Schühchen gezwängt werden. Ein Hund kann artgerechte Haltung nicht einfordern.
Der Hund stellt sich auf sein Herrchen ein. Er kann sich Gesichter merken, ihr Mienenspiel deuten und sucht darin Emotionen. Mops, Dackel und Dogge reagieren auf Lob wie Geschimpfe. Wie könnte der Mensch so viel Anteilnahme widerstehen? Noch dazu, wenn nur wenig das Verhältnis zwischen ihm und seinem Gefährten trüben kann.
Dankbar für Zeichen der Zuneigung und unerschütterliche Treue darf der Mensch also ruhig sentimental werden.